

Seit 2016 entsteht peu à peu die "Designstudie Kurzwellen-Empfänger" DKE-16. Auf Anregung und vielen Baugruppen, die Volker Banfield entwarf, bearbeitete und dankenswerterweise auch die Leiterplatten mit KICAD erstellte, wurde der Stand der Analogtechnik ausgereizt. Meine Frontplatte wurde mit dem Entwurfs-Programm der Fa. Schaeffer AG gestaltet, um ein professionelles Bild auf dem Stationstisch zu liefern. Weitere Details dazu auf Volkers Seite https://banfield.de/Elektronik/CMC3/frame.html (in den clickbaren PDF-Ikonen dort voll dokumentiert). So fanden wertvolle professionelle Bauelemente, die den hohen Stand der analogen Empfänger-Technik im letzten Jahrhundert prägten, eine würdige Umgebung und Einsatz.
Detailliertere technische Dokumentationen bei Volker oder auf
Anfrage. -- Die Frequenzaufbereitung ist digital und fußt auf der
weiter unten u.a.a.O. beschriebenen DDS-9912-Schaltung
(DL7IY[sk]/DL1FAC/DL7LA) sowie einem Arduino-328 für LO und BFO (Code für den AD9850
auf www.AD7C.com); einige
Anregungen und wesentlichen Anteil an der Filtertechnik hat auch
Olaf/DL7HA) beigetragen. Konzept ist ein klassisches
Doppelsuperprinzip (bei SSB/CW genau genommen wegen des BFO
Dreifachüberlagerung) mit hochliegender erster ZF 52,7 MHz und zweiter
ZF 1,4 MHz. Ein weiterer Arduino-328 arbeitet im CW-Decoder
(Goertzel-Algorithmus) nach OZ1JHM. -- Die Master-Frequenz der beiden
AD9912-DDS wird einem GPS-disziplinierten Oszillator (Leo Bodnar) mit
700 MHz entnommen (dessen zweiter Ausgang 10 MHz den Referenztakt für
einen externen Labor-Frequenzzähler liefert). Fallback ist ein
temperaturkompensierter Oszillator auf Si5370-Basis. Die
Taktquelle des AD9850-DDS ist dabei die Frequenz des 2. LO (je nach
Seitenbandlage 51,3 oder 54,1 MHz für den BFO und so ebenfalls GPS-synchron.
Umschaltbare Bandbreiten werden durch sechs 50Ω-Quarzfilter (Marconi,
KVG u.a.) zwischen 300 Hz und 10KHz realisiert. Für FM ist die vom
50Ω-Hybrid mit zwei KVG-Quarzfiltern der ersten ZF auf 52,7 MHz hinter
dem ersten Mischer bereitgestellte Bandbreite etwa 12 kHz geschaltet.
Die Schaltermischer nach PA3AKE erreichen IIP3-Werte > 40 dBm.
Außer einem 30-MHz-Tiefpass (MCL) und einer zusätzlichen
UKW-Rundfunkbandsperre gibt es keine Vorselektion (in praxi nicht
erforderlich).
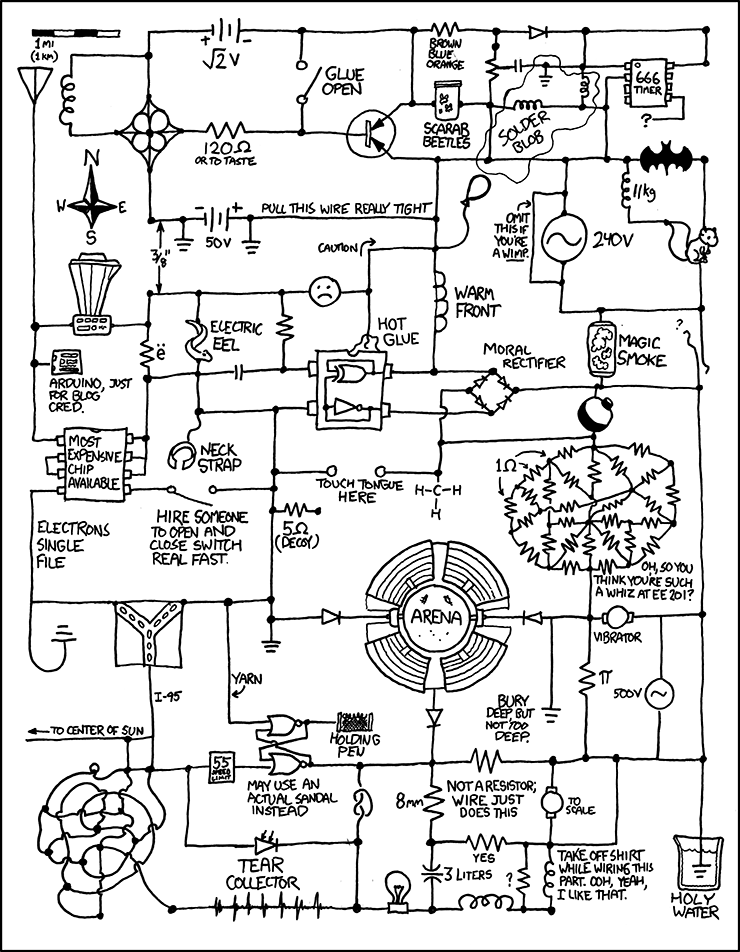
Website und Text befassen sich seit 2005 z.B. mit häufig vernachlässigten Besonderheiten bei Bauelementen.
Bei Ferriten sind 'alle Konstanten variabel'. Man stelle sich vor,
dass man eine Schaltung entwickeln müsste, in der die Widerstände aus
VDRs oder NTCs (nach Wahl des Kollegen Murphy) bestünden und alle
Kondensatoren aus großen Kapazitätsdioden (vgl. unten XR7). So ist es
keineswegs nur, was die Ferrite betrifft. Zitat DB1NV 2015 auf der UKW-Tagung Weinheim 'Transformatoren gelten unter Studenten als höchst suspekte Bauteile'
Kapazitive Bauelemente: Dass ein Elko andere Eigenschaften
als ein Wickelkondensator hat, dass es Keramikkondensatoren gibt, die trotzdem
für HF ungeeignet sind, ist alles akzeptiert und wohl einigermaßen
verstanden. Dass XR7-SMD-Kondensatoren hervorragende Mikrofone
sind oder dass sie bei Nennspannung u.U. nur noch 20%
ihrer nominellen Kapazität aufweisen können (also eigentlich Varicaps
sind, wie es sich alles z.B. bei einem Lieferanten wie AVX© nachlesen
lässt) dürfte auch heute noch so manchen Entwickler überraschen. Die elektrischen Abmessungen eines Kondensator mit hohem ε sind mit dessen Wurzel größer sind als die mechanischen, weil die Signalgeschwindigkeit entsprechend sinkt und induktive Wirkung entsteht (störende Serienresonanzen sind die Folge).
Cave ferner Widerstände: Errechnete Widerstände (z.B. das Z
einer Koax-Leitung) darf man nicht mit realen (die das Boltzmann-Rauschen
haben) vergleichen oder z.B. in der
Quellimpedanz einer HiFi- oder Senderendstufe durch reaktive Lasten oder SWR
>1,0 Verlustleistung erzeugen wollwn und verheizen. Auch der Innenwiderstand des Lichtnetzes ist so nicht bestimmbar. -- Achtung beim Programm LTSpice: Die Innenwiderstände der Spannungsquellen sind Null, diese Quellen daher beliebig leistungsfähig und müssen stets einen Innenwiderstand zugewiesen bekommen. Besser bei 50-Ω-Quellen ist es, eine 20-mA-Konstantstromquelle B mit einem Parallel-R von 50 Ω als Generator für 1 Veff einzusetzen.
Labor: Der Stromlauf links stammt von der Seite xkcd (zur
Lizenz siehe http://xkcd.org/license.html).
Gesucht wird
das Datenblatt des 666-Timers oben re.
.................N2ADR group on the web via http://groups.io

..........Selbstbau begonnen 2010 : SDR-Transceiver-Baustein, 10 kHz bis 60 MHz
Jim, N2ADR entwarf dieses 'Software
Defined Radio' für den Sende- und Empfangsbetrieb
(nach einem A/D-Wandler an der Antennenbuchse, der
alles digitalisiert, wird im Gerät nur noch mit den
digitalen Daten weitergearbeitet und letzlich ist erst
wieder für das Ohr die Rückwandlung in die analoge
Domäne notwendig; mathematische Verfahren treten an
die Stelle von Analogtechnik; das Endergebnis ist
aber immer von den Rohdaten abhängig, die analog
gewonnen werden und vom Wandler. Die Anforderungen an Präzision
verlagern sich auf den Eingang; dessen Probleme mit
Rauschen, Nichtlinearitäten bleiben erhalten, sie
erscheinen nur an anderer Stelle der Hardware.
PC-Software kann immer nur gering verbessern, was im
Analogteil beim HF-Teil vernachlässigt oder übersehen wurde.
Die Musterplatine im Bild entstand nach Jims
umfangreichen Unterlagen auf seiner Webseite. Anfang
Dez. 09 beschlossen Detlef, DL7IY✝ und Günter,
DL7LA, den Nachbau. Seit Anfang März
2010 sind beide Muster voll qrv. Eine Veröffentlichung in
Deutsch erschien im FUNKAMATEUR, Heft 8/2010 ab Seite
814.
Links im Bild liegt in der Mitte der
Eingangstransformator der Antenne, der über einen
Vorverstärker den ADC treibt. Die digitale
Verarbeitung erfolgt im FPGA (großer Baustein in der
Mitte) und UDP-Daten gehen über die
Ethernet-Schnittstelle (kleinerer Baustein rechts) in
den PC zur Weiterverarbeitung. Als
Software wird 'quisk' verwendet; seinerzeit unter Linux
Ubuntu 9.10, heute wird alles bis WinX unterstützt. Der Mikroschalter unten am Rand
ist improvisierter CW-Taster. Der Master-Takt
122,880 MHz kommt aus dem Clock-Baustein unten links.
Ein 14-bit-DAC erzeugt das HF-Sendesignal und ein
8-bit-DAC stellt die Sendeleistung ein (bis ca. 0 dBm
Nominalpegel). Diese Leiterplatte ist nur doppelseitig,
es sind daher auf der Rückseite noch diverse
Drahtbrücken vorhanden, die z.B. die Speisespannungen
verteilen. Die Stromaufnahme beträgt max. (bei
Sendebetrieb) 1 A bei 3,3 V, alle weiter erforderlichen
Spannungen (1,2 und 2,5V für den FPGA-Core werden
von Spannungsreglern auf der Platine aus der
3,3-V-Versorgung gewonnen).
Eine Besprechung der 'quisk'-Bedienoberfläche gab es im
Artikel von Olaf, DL4DZ, im FUNKAMATEUR 4/10, p. 397.
Quisk 2020 arbeitet übrigens
auch mit Soundkarten-Programmen wie fldigi zusammen
und kann auch mit Geräten wie dem K3 zusammenarbeiten; die soapy-Schnittstelle ist in Arbeit.
Empfangen wird in CW/SSB/AM/FM/FreeDV, Sendebetriebsarten
ebenso, die (von 48 bis 960 kHz einstellbare)
Darstellungsbreite ist normalerweise um 240 kHz, so
dass man z.B. 80-m-Fonie in einem Rutsch überblickt.
Jims Decimationsraten sind einstellbar, so sind
48 kHz für genauere Darstellung bis 960 kHz (zur
Beobachtung von VHF/UHF-Transverter-Bereichen,
schneller Rechner bei 960 kHz erforderlich) verfügbar.
PC und Transceiver sind bei DL7LA mit über denselben
Router verbunden, der auch die DSL-Dienste im
heimischen Netzwerk zur Verfügung stellt.
Als proof of concept lief das System mit einem nur über
WLAN angebundenem Netbook.
Die Länge der Verbindung nicht wie bei
USB begrenzt; eine Fernsteuerung über das Internet ist
leicht realisierbar. Die Lizenzprobleme bei USB2.0
unter Linux entfallen vollständig. Wegen der
galvanischen Trennung im Ethernet fallen auch evtl.
HF- und Brummschleifen weg. Sämtliche Kommunikation
erfolgt über UDP. Das Mikrofon und der
Stationslautsprecher wird an der (einfachen, 16 Bit
eingebaut ausreichend) Soundkarte des PC
angeschlossen, (oder man verwendet ein USB-Headset);
die Modulation wird durch einen digitalen
Dynamikprozessor in punkto Lautstärke und Frequenzgang
mitbestimmt. Getastet (T/R bzw. CW) wird die Platine
direkt oder seriell vom PC aus. Als Testsignal liefert ein besonderer Button
ein digital generiertes Zweitonsignal mit 0, -3 und -6
dBm und einer spektralen Reinheit von 14 bit, also
praktisch etwa -75 dBc auf allen Frequenzen, die der
TRX sendemaeßig erzeugen kann.
Alle Software ist frei in die GPL gestellt. Für das
Laden der Firmware der Platine, die in Verilog(©)
vorliegt, ist der oben im Bild liegende
Programmieradapter 'USB-Blaster (©)' notwendig
(Anschluss über 10pol Wannenstecker oben am
Platinenrand). Dieses bei Jim (http://james.ahlstrom.name) Programm wird mit der ebenfalls
vom Hersteller des FPGAs im Netz kostenlos zur
Verfügung stehenden Software QUARTUS© unter Windows(©)
kompiliert und in das EEPROM geladen; beim Einschalten
der Speisespannung lädt das FPGA sich diesen Inhalt
und das Programm startet nach ca. 1 sec.. Weitere Firmwares hat Stefan, DL2STG, erstellt.
Für den kompletten Transceiver müssen
weitere Baugruppen, wie PA und Tiefpässe etc.
mitgeschaltet werden. Jim stellt auch dafür im
Download verschiedene Programmvarianten vor. Ohne
großen Aufwand kann dies z.B. mit dem AVR-NetIO auch
über Ethernet realisiert werden. Der
Python-Code ist frei und kann vom Benutzer angepasst /erweitert werden.
Begonnen mit Quanta Plus
3.4.0 unter SuSe 9.3 (Linux 2.6.11.4-21.15)
und KDE 3.4.0 Level "b"weiterbearbeitet mit Quanta
3.5 unter Ubuntu 8.10/ Ubuntu 9.04/ Ubuntu
10.04LTS. --- 2005..2011. Immer
immer wieder und zuletzt aktualisiert und
bereinigt 2020 (Ubuntu 18.04 LTS).
Wise men don't need
advice. Fools don't
take it. --Benjamin
Franklin
Copyright Notice. This
article, including but not limited to all
text and diagrams, is the intellectual
property of the author, and is Copyright
2006-2020. Reproduction or re-publication by
any means whatsoever, whether electronic,
mechanical or electro- mechanical, is
strictly prohibited under International
Copyright laws. The author grants the reader
the right to use this information for
personal use only, and further allows that
one (1) copy may be made for reference.
Commercial use is prohibited without express
written authorisation by Guenter Richter.t>
Good
decisions come from experience; experience
comes from bad decisions. -- Mark Twain
Home of Gabi und Günter Richter